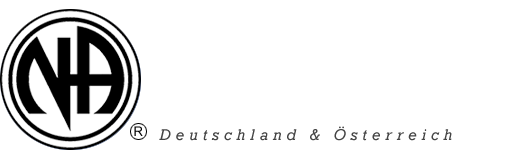Entschleunigung
Wie ich die Langsamkeit entdeckte
Unschlüssig stehe ich in meinem Bad. Was ich fühle ist Lähmung. Ich bin müde und es gibt noch so viel zu erledigen.
Übermorgen beginnt mein neues Arbeitsverhältnis und mir geht das alles zu schnell.
Nicht, dass ich nicht neue Aufgaben brauche. Nein, mir ist sogar teilweise richtig langweilig.
Ich spüre gerade den Druck, dass ich nur noch wenige Stunden habe, alles zu erledigen, wozu ich dann keine Zeit mehr haben werde.
Das macht mich müde.
Es ist so, diese neue Doro kenne ich nicht. Diese neue Doro braucht viel mehr Zeit.
Ich bin es gewohnt, dass es mir bisher nie schnell genug gehen konnte. Mit allem. Sogar die Geburten meiner Söhne waren sensationell schnell: Ohne Betäubung, ohne ärztliche Hilfe.
Ruckizucki durchgezogen.
Von den Glücksgefühlen dabei war ich fasziniert…
Keine Freude ohne Schmerz war meine Haltung dazu.
So in etwa bin ich durch alles durchgegangen. Augen zu und durch.
Ohne Rücksicht.
Zu viel gab es nicht.
Zu wenig allerdings schon. Nämlich dann, wenn mir bei meinem Tempo die Guten Sachen verloren gingen.
Wenn ich nicht innehielt und mir nicht die Zeit nahm, meine Gefühle zu überprüfen.
Hätte ich die Schwangerschaft verlassen können und die Austragung meiner Söhne jemandem anderen überlassen können: Vermutlich hätte ich es getan.
Ich hatte mir in dieser Zeit eine Erinnerung unter die Haut stechen lassen.
Die, dass ich bleibe, auch wenn es schwierig wird und ich keine Lösung habe.
Hätte ich statt des Tattooartists eine Therapie besucht, hätte ich vermutlich auch eine Lösung für die Wurzel des ganzen gefunden.
Denn das stellt sich gerade als der fehlende Baustein heraus.
Ich habe mir danach noch einige Erinnerungen mehr stechen lassen. Viele inhaltlich ähnlich. Mein Körper ist ein scheiß Notizzettel!
Das alles ist heute nur noch eine absurde Erinnerung daran, dass ich nicht verstanden habe, worum es eigentlich ging.
Nicht darum zu bleiben, sondern lange vorher das Tempo drosseln um die vielen, auch leisen, Stimmen zu hören, die mir verraten was ich eigentlich brauche.
Ich hätte dann viel öfter gefragt: „Was brauchst du?“ Und mich dasselbe gefragt. Leiser und kompromissbereiter.
Ich wäre einmal weniger wie ein Bulldozer durch die Welt gerauscht. Nichtsahnend, dass ich aus meinem Trauma handle und in Dauerschleife immer wieder die selben Fehler begehe.
Seit einiger Zeit ist es still geworden.
Das Leben hat mir eine Auszeit geschenkt. Ich darf atmen, meditiere zum ersten Mal ernsthaft, bete und höre meinen Gedanken endlich mal nicht zu.
Ich folge nicht jedem Impuls.
Meine Gefühle verändern sich. Ich weiß jetzt, dass sie kommen und gehen.
Was ich fühle, ist ein Geschenk. Schwer zu verstehen, als ich zum ersten Mal mit Ihnen in den Ring stieg. Die Unsicherheit, die Ohnmacht, das Alleinsein, die Trauer, die Angst, die Scham…
Neu ist auch, dass ich weine. Leise und laut für mich und manchmal in Anwesenheit von anderen.
Die ersten Schritte waren wie meine Geburten, nur dass der Prozess mehrere Wochen anhielt und ich nicht wusste, wann und wie er endet.
Ich war wie ein Kleinkind: Überfordert und durchgepeitscht vom brennenden Schmerz, nicht ahnend, dass dieser ein Ende hat.
Das war der Unterschied zu den Geburten meiner Söhne.
Ich nehme daraus mit, dass ich vertrauen darf. Ich bin nicht meine Gedanken. Diese und meine Gefühle sind wie Wolken.
Die Zeit ist auf meiner Seite.
Solche Prozesse sind wie eigene Organismen. Es ist meine Entscheidung, ob ich brandschatze, in besinnungsloser Wut umpflüge und drauf haue und Zerstörung ernte.
Oder mich für den Weg entscheide, mich auszuhalten und mit meiner Krankheit in den Dialog zu gehen.
Für heute entscheide ich mich erstmal wieder ins Bett zu gehen.
Doro